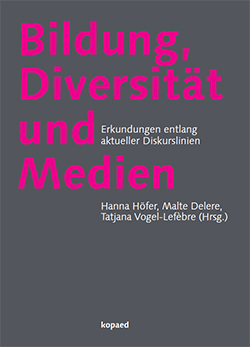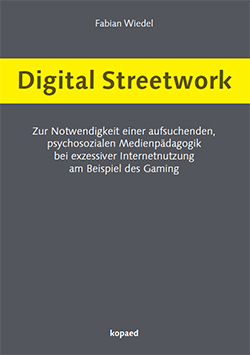Kindheit, Jugend und Medien
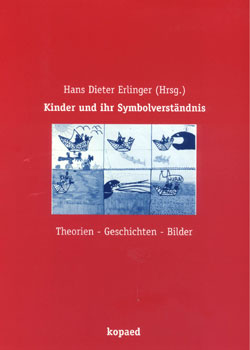
ISBN 978-3-935686-11-2
Im Verlagsprogramm unter
Produktbeschreibung
Wer Mitglied in einer Gesellschaft sein will, muss mit ihr in Kommunikation treten. Das gilt auch für Kinder – von Anfang an. Von besonderem Interesse ist, welche Mittel Kinder dazu benutzen und tauglich finden, denn dass es nicht die der Erwachsenen sind, dürfte einleuchten. Der Band geht der Frage nach, welche Rolle Symbole dabei spielen, Symbole in gemalten und in verbal erzählten Geschichten, die kindliches Selbst- und Weltverständnis zum Ausdruck bringen. Thematisiert wird dabei auch das mediale Wissen von Kindern, auf das sie sich dabei stützen können.
Komplettiert und fundiert werden diese Materialien durch die Vorstellung von Theorien zum kindlichen Spiel und ihrer Symbolverwendung in interaktiven Zusammenhängen.
Komplettiert und fundiert werden diese Materialien durch die Vorstellung von Theorien zum kindlichen Spiel und ihrer Symbolverwendung in interaktiven Zusammenhängen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Clemens Knobloch
„Kritische Kontexte“ in der Entwicklung der kindlichen Symbol- und Erzählfähigkeit
1. Einleitung
2. Drei Lesarten von „Symbol”
3. „Medien“ der kindlichen Symbolproduktion
4. Symbol- und Fiktionsspiel
5. Kollektives Symbolspiel: die Rolle der Sprache in den Anfängen
6. „Theory of mind“ und mehrperspektivische Narration
Hans Dieter Erlinger
Kinder erzählen. Narrative Antworten auf mediale Angebote
1. Einleitung
2. Das materiale Wissen
2.1 Muster: verpflanzte erlebte Realität, Beispiel Urlaub
2.2 Muster: prototypisches Weltwissen als Schablone, Beispiele Afrika und Alaska
2.3 Muster: prototypisches fiktionales Wissen
3. Narratives Wissen: Komplikation und Spannungsaufbau
4. Heldentypologie
5. Schlußbemerkungen
Bettina Lange
Narrative Strukturen in (Kinder-)Geschichten und eine Analyse ihrer formalen Kennzeichen
Vorbemerkung
I. Von der Notwendigkeit, Geschichten zu erzählen
1. Geschichten-Erzählen als Organisation der Erfahrung
2. Auf der Suche nach Sinn und Bedeutung
3. Individuelle Erfahrung als kulturelle Erfahrung
3.1 Die Bereitschaft, das Ungewöhnliche zu markieren
und das Gewöhnliche unmarkiert zu lassen
3.2 Die „Linearisierung“ und das standardisierte Aufrechterhalten der Ereignisabfolge
4. Die Fragestellung
II. Analyse der (Kinder-)Geschichten
1. Formale Kennzeichen als Werkzeuge der Bildanalyse
2. Beschreibender Teil
2.1 Die Horizontlinie
2.2 Die Raumblase
2.3 Die narrative Struktur und ihre formalen Kennzeichen
3. Vergleichender Teil: Die Kindergeschichten im Vergleich mit anderen Erzählungen
3.1 Die Grenzüberschreitung
3.2 Die Grenzüberschreitung des ,Jona im Walfischbauch’
3.3 Die neue Welt: „Das Spiel des Gegenteils im Meer des Entgegengesetzten“
3.4 Der Kampf um das Gute – zum Sinn einer ,Gegenwelt’ aus mythologischer Perspektive
III. Kulturtheoretische Zugänge zum Thema
1. Ernst Cassirer: Symbolische Formen
1.1 Die Funktion der Ausdrucksgestaltung
1.2 Die symbolische Form des Mythos
1.3 Die Funktionen des Mythos
1.4 Schlussfolgerung
1.5 Symbolisierung, der Weg zur Ausdrucksgestaltung
a) Die Bedeutung für das Individuum
b) Die Bedeutung für den öffentlichen Bereich der Kultur
1.6 Zusammenfassung – der Mensch als animal symbolicum
2. Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis
3. Norbert Bischof: Das Kraftfeld der Mythen
4. Quellen des Selbst: Charles Taylor
5. Zusammenfassung – kulturtheoretische Zugänge
IV. Resümee
Literatur
Clemens Knobloch
„Kritische Kontexte“ in der Entwicklung der kindlichen Symbol- und Erzählfähigkeit
1. Einleitung
2. Drei Lesarten von „Symbol”
3. „Medien“ der kindlichen Symbolproduktion
4. Symbol- und Fiktionsspiel
5. Kollektives Symbolspiel: die Rolle der Sprache in den Anfängen
6. „Theory of mind“ und mehrperspektivische Narration
Hans Dieter Erlinger
Kinder erzählen. Narrative Antworten auf mediale Angebote
1. Einleitung
2. Das materiale Wissen
2.1 Muster: verpflanzte erlebte Realität, Beispiel Urlaub
2.2 Muster: prototypisches Weltwissen als Schablone, Beispiele Afrika und Alaska
2.3 Muster: prototypisches fiktionales Wissen
3. Narratives Wissen: Komplikation und Spannungsaufbau
4. Heldentypologie
5. Schlußbemerkungen
Bettina Lange
Narrative Strukturen in (Kinder-)Geschichten und eine Analyse ihrer formalen Kennzeichen
Vorbemerkung
I. Von der Notwendigkeit, Geschichten zu erzählen
1. Geschichten-Erzählen als Organisation der Erfahrung
2. Auf der Suche nach Sinn und Bedeutung
3. Individuelle Erfahrung als kulturelle Erfahrung
3.1 Die Bereitschaft, das Ungewöhnliche zu markieren
und das Gewöhnliche unmarkiert zu lassen
3.2 Die „Linearisierung“ und das standardisierte Aufrechterhalten der Ereignisabfolge
4. Die Fragestellung
II. Analyse der (Kinder-)Geschichten
1. Formale Kennzeichen als Werkzeuge der Bildanalyse
2. Beschreibender Teil
2.1 Die Horizontlinie
2.2 Die Raumblase
2.3 Die narrative Struktur und ihre formalen Kennzeichen
3. Vergleichender Teil: Die Kindergeschichten im Vergleich mit anderen Erzählungen
3.1 Die Grenzüberschreitung
3.2 Die Grenzüberschreitung des ,Jona im Walfischbauch’
3.3 Die neue Welt: „Das Spiel des Gegenteils im Meer des Entgegengesetzten“
3.4 Der Kampf um das Gute – zum Sinn einer ,Gegenwelt’ aus mythologischer Perspektive
III. Kulturtheoretische Zugänge zum Thema
1. Ernst Cassirer: Symbolische Formen
1.1 Die Funktion der Ausdrucksgestaltung
1.2 Die symbolische Form des Mythos
1.3 Die Funktionen des Mythos
1.4 Schlussfolgerung
1.5 Symbolisierung, der Weg zur Ausdrucksgestaltung
a) Die Bedeutung für das Individuum
b) Die Bedeutung für den öffentlichen Bereich der Kultur
1.6 Zusammenfassung – der Mensch als animal symbolicum
2. Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis
3. Norbert Bischof: Das Kraftfeld der Mythen
4. Quellen des Selbst: Charles Taylor
5. Zusammenfassung – kulturtheoretische Zugänge
IV. Resümee
Literatur