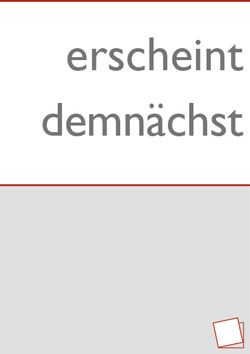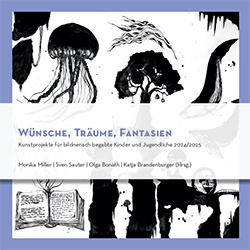Kunstpädagogik
Ästhetische Erfahrung in der frühen Kindheit
Empirische Studien über ästhetische Erfahrungsprozesse in offenen Lernumgebungen im Kindergarten
München 2024, 527/324 Seiten (Teile zum Download)
ISBN 978-3-96848-150-0
Im Verlagsprogramm unter
Produktbeschreibung
Heutige Kindheit ist geprägt von großen Herausforderungen, die Fragen nach Mitbestimmung und Mitgestaltung aufwerfen. Als genuin ressourcenorientierter Bildungsbereich kann ästhetische Bildung einen wichtigen Beitrag zur gelingenden Bewältigung dieser Lebensanforderungen leisten und schon junge Kinder auf ihrem Weg zu einem verantwortungsbewussten, sinnerfüllten und salutogenen Leben begleiten.
In der Kunstpädagogik wird ästhetische Erfahrung als Kern ästhetischer Bildung erachtet, doch muss geklärt werden, was hierunter zu verstehen ist. Auf Basis von Theoriemodellen über ästhetische Erfahrung aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen sowie entwicklungspsychologischer Voraussetzungen junger Kinder hierzu, verbindet die phänomenologische Forschungsarbeit erstmalig gesamthaft konstitutive Merkmals- und Verlaufsstrukturen ästhetischer Erfahrungsprozesse.
Die neu gewonnenen Erkenntnisse geben einerseits Aufschluss über die Qualität derartiger Erfahrungsprozesse und zeigen andererseits ihren potentiellen Bildungswert für den kunstpädagogischen und frühpädagogischen Bereich auf.
kh_kapitel4
In der Kunstpädagogik wird ästhetische Erfahrung als Kern ästhetischer Bildung erachtet, doch muss geklärt werden, was hierunter zu verstehen ist. Auf Basis von Theoriemodellen über ästhetische Erfahrung aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen sowie entwicklungspsychologischer Voraussetzungen junger Kinder hierzu, verbindet die phänomenologische Forschungsarbeit erstmalig gesamthaft konstitutive Merkmals- und Verlaufsstrukturen ästhetischer Erfahrungsprozesse.
Die neu gewonnenen Erkenntnisse geben einerseits Aufschluss über die Qualität derartiger Erfahrungsprozesse und zeigen andererseits ihren potentiellen Bildungswert für den kunstpädagogischen und frühpädagogischen Bereich auf.
kh_kapitel4
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 15
1.1 Forschungsinteresse 15
1.2 Theoretische Bezugspunkte 16
1.3 Struktur der Forschungsarbeit 17
2 Theoretische Situierung 21
2.1 Grundannahmen über ästhetische Erfahrung 21
2.1.1 Bedeutung ästhetischer Erfahrung für das Lebensalter der frühen Kindheit 22
2.1.2 Struktur von Erfahrungsprozessen 23
2.1.3 Ästhetischer Modus von Erfahrung 24
2.1.4 Kindliche und ästhetische Prozesse 26
2.1.5 Konsequenzen für die Forschungsarbeit 26
2.2 Modelle und Konzepte über die Struktur ästhetischer
Erfahrungsprozesse 27
2.2.1 Theorienmodelle aus Kunstpädagogik und Erziehungswissenschaft 27
2.2.1.1 Kunstpädagogik: Strukturmerkmale ästhetischer Erfahrungsprozesse
nach Georg Peez 28
2.2.1.2 Erziehungswissenschaft: Strukturmomente ästhetischer Erfahrung nach Ludwig Duncker 30
2.2.1.3 Synopse der Theoriemodelle aus Kunstpädagogik
und Erziehungswissenschaft 33
2.2.2 Theoriemodelle aus Philosophie, Psychologie und Soziologie 34
2.2.2.1 Philosophie: Thesen über die Struktur ästhetischer Erfahrung
nach Martin Seel 34
2.2.2.2 Psychologie: Kognitionspsychologisches Modell ästhetischer
Erfahrung nach Benno Belke und Helmut Leder 36
2.2.2.3 Soziologie: Struktureigenschaften ästhetischer Erfahrung
nach Ulrich Oevermann 39
2.2.2.4 Synopse der Theoriemodelle aus Philosophie,
Psychologie und Soziologie 41
2.2.3 Synthese der fünf Theoriemodelle 42
2.2.3.1 Theorieverständnisse von ästhetischer Erfahrung 42
2.2.3.1.1 Ästhetische Ausprägung von Erfahrung 43
2.2.3.1.2 Disposition des Subjekts 45
2.2.3.1.3 Entstehung ästhetischer Erfahrung 46
2.2.3.1.4 Ästhetische Erfahrung in Kunst und Alltag 48
2.2.3.2 Strukturbestimmungen von ästhetischer Erfahrung 49
2.2.3.2.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Theoriemodelle 49
2.2.3.2.2 Struktur- und Prozessmodell 50
2.2.3.2.3 Strukturmerkmale 51
2.3 Ästhetische Erfahrung in der frühen Kindheit 55
2.3.1 Theoretische Grundannahmen über ästhetische Erfahrung im Kindesalter 55
2.3.2 Wahrnehmung 59
2.3.2.1 Entwicklungspsychologie 59
2.3.2.2 Kunstpädagogik 62
2.3.3 Emotion 64
2.3.3.1 Entwicklungspsychologie 64
2.3.3.2 Kunstpädagogik 66
2.3.4 Kognition 68
2.3.4.1 Entwicklungspsychologie 69
2.3.4.2 Kunstpädagogik 75
2.3.5 Exploration und Spiel 81
2.3.5.1 Entwicklungspsychologie 82
Exploration 83
Spiel 85
2.3.5.2 Kunstpädagogik 87
Experimentieren 88
Spielen 89
2.4 Relevanz der theoretischen Grundlagen
für die empirische Untersuchung 92
3 Grundlagen der empirischen Untersuchung 95
3.1 Forschungsstand 95
3.2 Methodologische Grundsatzüberlegungen der Forschungsarbeit 99
3.2.1 Qualitative Kindheitsforschung 99
3.2.2 Gegenstandsangemessenheit der verwendeten Forschungsmethoden 102
3.2.2.1 Handlungsbeobachtung 102
3.2.2.1.1 Teilnehmende Beobachtung 103
3.2.2.1.2 Videografie 106
3.2.2.1.3 Kombination von Teilnehmender Beobachtung und Videografie 111
3.2.2.2 Interview 112
3.2.2.2.1 Qualitative Interviews mit Kindern 112
3.2.2.2.2 Kind-angemessene Interviewformen 115
3.2.2.3 Phänomenologische Analyse 118
3.2.3 Anlage der empirischen Untersuchung 120
3.2.4 Setting 126
3.2.5 Fallauswahl 131
4 Einzelfallanalysen 133
4.1 Fallbeispiel 1: Salome 133
4.1.1 Rekonstruktion des Handlungsprozesses von Salome 133
4.1.1.1 BE 1: Die graphischen Äußerungen des Kindes 135
4.1.1.1.1 Exploratives Verhalten 135
4.1.1.1.2 Spuren hinterlassen mit dem eigenen Körper 139
4.1.1.1.3 Handlungsmotive des Spurenerzeugens 142
4.1.1.1.4 Graphische Äußerungen zwischen Zeichnen und Malen 145
4.1.1.2 BE 2: Arbeiten mit dem Material Flüssigklebstoff 148
4.1.1.2.1 Materialumgang 148
4.1.1.2.2 Exploratives Handeln mit einem ungewöhnlichen Zeichenmaterial 151
4.1.1.2.3 „Das Gleiche immer anders“ –
Vertiefung durch Wiederholung und Modifikation 153
4.1.1.3 BE 3: Papier-Rollen 156
4.1.1.3.1 Erschaffung eines Kreises mittels Zeichenhilfe 156
4.1.1.3.2 Die selbst hergestellte Papierrolle 159
4.1.1.3.3 „Der Kreis schließt sich“ –
Gemeinsamkeit der Handlungsphasen mit Papierrollen 164
4.1.1.4 BE 4: Wechsel als ein dem bildnerischen Prozess innewohnendes Element 165
4.1.1.4.1 Körper und Bewegung 165
4.1.1.4.2 Bildnerische Grundsatzentscheidungen 169
4.1.1.4.3 Fließende und abrupte Übergänge 177
4.1.1.5 BE 5: Autonomiebestreben des Kindes 177
4.1.1.5.1 Autonomes Verhalten im bildnerischen Prozess 177
4.1.1.5.2 Grenzen des Autonomiebestrebens 181
4.1.1.6 BE 6: Bekanntes und Vertrautes 182
4.1.1.6.1 Die Bedeutung vertrauter Personen für den bildnerischen Prozess 182
4.1.1.6.2 Die Bedeutung bekannter Materialien für den bildnerischen Prozess 187
4.1.1.7 BE 7: Ordnung und Regeln 191
4.1.1.7.1 Materialnutzung 191
4.1.1.7.2 Reaktionen auf Handlungsaufforderungen 193
4.1.2 Rekonstruktion des Interviews mit Salome 197
4.1.2.1 BE 1: Klebstoffnutzung 198
4.1.2.1.1 Verwendungsformen des Materials Flüssigklebstoff 198
4.1.2.1.2 Klebstoff als Zeichenmaterial in Verbindung mit einer
Motivvorstellung 201
4.1.2.1.3 Auswirkung der Klebstoffnutzung auf den bildnerischen Prozess 202
4.1.2.2 BE 2: Das „Schneiden“ und das „Ausgeschnittene“ 203
4.1.2.2.1 Relevanz des Ausgeschnittenen 203
4.1.2.2.2 Eigene Interessen vertreten 205
4.1.2.2.3 Von der Ersatzhandlung zum Verfolgen eigener Interessen 207
4.1.2.2.4 Stellenwert des Aus-Schneidens 208
4.1.2.3 BE 3: „Kreis als Metapher“ – Bedeutung des Kreises und des Kreisens 209
4.1.2.3.1 Zwischen Prozesserleben und Zielausrichtung 209
4.1.2.3.2 „Kreisende Annäherungen“ – Versuche zur Erzeugung von Kreisen 210
4.1.2.3.3 Kreismotiv als zentrales Prinzip des Handlungsprozesses 214
4.1.2.4 BE 4: Prozesserleben 216
4.1.2.4.1 Ganzheitliches Erleben des Handlungsprozesses 216
4.1.2.4.2 Bewusste und unbewusste Handlungsentscheidungen 217
4.1.2.4.3 „Sich im Kreise drehen“ – Ineinandergreifen von Handlungen 218
4.1.2.5 BE 5: Der bildnerische Prozess als Problemlöseprozess 219
4.1.2.5.1 Herausforderungen 219
4.1.2.5.2 Scheitern und Erfolg 222
4.1.2.6 BE 6: Kognitive Durchdringung des Handlungsprozesses 226
4.1.2.6.1 Sprechen über den zurückliegenden Handlungsprozess 227
4.1.2.6.2 Antizipation bildnerischer Vorhaben 229
4.2 Fallbeispiel 2: Ben 232
4.2.1 Rekonstruktion des Handlungsprozesses von Ben 232
4.2.1.1 BE 1: Das Objekt „Holzkästchen“ und damit
verbundene Handlungsformen 234
4.2.1.1.1 Äußere Merkmale und Funktion des Objekts 234
4.2.1.1.2 Interesse am Objekt 236
4.2.1.1.3 Verschiedene Tätigkeiten mit dem Objekt 237
4.2.1.2 BE 2: Handlungen mit dem Material Flüssigklebstoff 239
4.2.1.2.1 Materialhandlungen in Zusammenhang mit dem Objekt
„Holzkästchen“ 239
4.2.1.2.2 Materialexploration 243
4.2.1.2.3 Erkenntnis: Materialeigenschaft Viskosität 245
4.2.1.2.4 Vergleich der Handlungen mit dem Material Flüssigklebstoff 246
4.2.1.2.5 Sinnliches Erleben des Materials 247
4.2.1.3 BE 3: Herstellung von „weißem Kleber“ 249
4.2.1.3.1 Von der Exploration zur Produktion 249
4.2.1.3.2 Bedeutung von Prozess und Produkt 250
4.2.1.3.3 Autonomie und Anerkennung 253
4.2.1.4 BE 4: Gleichförmigkeit des Handlungsprozesses 254
4.2.1.4.1 Konstanz der verwendeten Materialien 254
4.2.1.4.2 Gleichförmigkeit der Handlungen 256
4.2.1.5 BE 5: Ruhe und Ausgeglichenheit des Kindes 259
4.2.1.5.1 Beobachten und Handeln 259
4.2.1.5.2 Strategien der Weiterführung von Handlungen 262
4.2.1.5.3 Reaktionen auf Störungen 264
4.2.1.5.4 Kontakt zum Gegenstand 266
4.2.1.6 BE 6: Vorbilder suchen und Vorbild sein 268
4.2.1.6.1 Soziale Rahmung der Handlungssituation 268
4.2.1.6.2 Bildnerische Orientierungspunkte im Handlungsprozess 271
4.2.1.6.3 Körper und Handlung 273
4.2.1.7 BE 7: Regeln und Umgangsformen 274
4.2.1.7.1 Regelkonformes Verhalten 274
4.2.1.7.2 Regelbrüche 276
4.2.2 Rekonstruktion des Interviews mit Ben 279
4.2.2.1 BE 1: „Weißer Kleber“ 281
4.2.2.1.1 Wichtigkeit des aus dem Handlungsprozess hervorgegangenen
Erzeugnisses 281
4.2.2.1.2 Ein „Klebdings“ basteln 283
4.2.2.1.3 Ausschließlichkeit in Bezug auf die inhaltliche Schwerpunktsetzung 284
4.2.2.1.4 Klebstoffherstellung 286
4.2.2.2 BE 2: Handlungen mit dem Material Flüssigklebstoff 287
4.2.2.2.1 Klebstoffexploration 287
4.2.2.2.2 „Malen“ mit Flüssigklebstoff 289
4.2.2.3 BE 3: Offenheit für Materialien und Tätigkeiten 291
4.2.2.3.1 Prinzipielle Austauschbarkeit von Materialien und Verfahren 291
4.2.2.3.2 Relevanz von Zufällen im bildnerischen Prozess 292
4.2.2.4 BE 4: Ästhetische Werturteile 295
4.2.2.4.1 Objekte bewerten 296
4.2.2.4.2 Prozesse bewerten 298
4.2.2.5 BE 5: Der Handlungsprozess im Kontext des Sozialgefüges 299
4.2.2.5.1 Bildnerische Orientierung an anderen 299
4.2.2.5.2 Von der übernommenen Tätigkeit zur eigenständigen Idee 301
4.2.2.5.3 Vorbilder haben und Vorbild sein 303
4.2.2.5.4 Von der Einzel- zur Teamarbeit 305
4.2.2.5.5 Soziale Beziehung 307
4.2.2.6 BE 6: Körper und Sprache 309
4.2.2.6.1 Redebeteiligung am Interview 309
4.2.2.6.2 Sprachliche Gestaltungsmittel und körpersprachliche
Ausdrucksformen 311
4.2.2.6.3 Gefühlsäußerungen 313
4.2.2.6.4 Atmung 315
4.3 Zusammenfassungen der Einzelfälle 316
4.3.1 Der Einzelfall Salome 316
4.3.2 Der Einzelfall Ben 318
4.3.3 Synopse der beiden Einzelfälle 319
4.4 Reflexion der Forscherrolle 321
4.4.1 Auswirkung der forschungsmethodischen Entscheidungen
und Vorgehensweisen bei der Datenerhebung der Handlungssituationen 322
4.4.1.1 Verhalten im Feld 322
4.4.1.2 Einfluss des theoretischen Vorverständnisses auf die Datenerhebung 323
4.4.2 Auswirkung der forschungsmethodischen Entscheidungen und
des forschungsmethodischen Vorgehens bei der Datenerhebung der Interviews 325
4.4.2.1 Qualitatives Interview 325
4.4.2.2 Alter der Probanden 327
4.4.2.3 Sozialform 328
4.4.2.4 Fotografien als Erzählstimulus 330
4.4.3 Konsequenzen für die Datenauswertung 333
5. Synthetische Interpretation der Einzelfallanalysen 337
5.1 Strukturmerkmale ästhetischer Erfahrung 338
5.1.1 Einstellung 338
5.1.1.1 Offenheit 338
5.1.1.2 Flexibilität 341
5.1.1.3 Interesse 343
5.1.2 Wahrnehmung 344
5.1.2.1 Intermodale Wahrnehmung 345
5.1.2.2 Aufmerksamkeit 346
5.1.2.3 Konzentration 348
5.1.3 Handlung 349
5.1.3.1 Körperliche Aktivität 350
5.1.3.2 Aktivitäten der Welterschließung 353
5.1.3.2.1 Exploratives Handeln 353
5.1.3.2.2 Spielerisches Handeln 355
5.1.4 Emotion 360
5.1.4.1 Selbstgenügsamkeit und Funktionslust 360
5.1.4.2 Positiv-emotionales Erleben 362
5.1.4.3 Sinnlich-emotionales Erleben 364
5.1.4.4 Ambivalente Gefühle 366
5.1.5 Motivation 367
5.1.5.1 Selbstwirksamkeit und Autonomie 368
5.1.5.2 Prozesse des Lernens 371
5.1.5.3 Entwicklungsstreben 375
5.1.6 Kognition 381
5.1.6.1 Denken und Erkenntnis 381
5.1.6.1.1 Handlungsbezogene Kognitionen 382
5.1.6.1.2 Handlungsabsicht 384
5.1.6.1.3 Staunen und Irritation 388
5.1.6.1.4 Wissen 389
5.1.6.2 Imagination 391
5.1.6.2.1 Vorstellung und Anschaulichkeit 392
5.1.6.2.2 Realität und Phantasie 392
5.1.6.2.3 Interdependenz von Bildvorstellung und bildnerischer Tätigkeit 393
5.1.6.2.4 Auswirkung von Kenntnissen auf die Entstehung von
Bildvorstellungen 394
5.1.6.2.5 Einfluss kontextueller Vorgaben auf die Realisation von
Bildvorstellungen 395
5.1.6.3 Reflexion 396
5.1.7 Ausdruck 400
5.1.7.1 Sprache 400
5.1.7.2 Objektivation 405
5.2 Prozessmerkmale ästhetischer Erfahrung 408
5.2.1 Rhythmus 409
5.2.1.1 Gleichförmigkeit und Wechsel 409
5.2.1.2 Körpererleben 412
5.2.1.3 Wechsel der Spannungszustände 413
5.2.2 Prozessentwicklung 414
5.2.2.1 Aktivitätszustand 414
5.2.2.2 Kontinuität und Brüche 415
5.2.2.3 Prozesshafte Entwicklung der Handlung 416
5.2.2.4 Aufrechterhaltung des Prozesses 418
5.2.2.5 Zusammenhänge zwischen Handlungsphasen 421
5.2.2.6 Prozessformen 424
5.2.2.7 Entwicklung von Bildvorstellungen 425
5.2.3 Intensität 426
5.2.3.2 Momentaneität und Simultaneität 427
5.2.3.3 Konzentration und Ausdauer 428
5.2.3.4 Prozess und Produkt 429
5.2.3.5 Monotonie und Abwechslung 430
5.3 Kindspezifische Merkmale ästhetischer Erfahrung 433
5.3.1 Motorik: Körperwahrnehmung und Körperbewegung 434
5.3.1.1 Zusammenwirken von Wahrnehmung und Motorik 434
5.3.1.2 Auswirkung der Motorik auf ästhetische Erfahrungsprozesse 435
5.3.1.3 Relevanz der Körperwahrnehmung für ästhetische Erfahrungsprozesse 436
5.3.2 Motivation: Personale und soziale Bezogenheit 439
5.3.2.1 Handlungsmotiviertes Tun 439
5.3.2.2 Körperliches Tun 440
5.3.2.3 Selbstzweckhaftes Tun 441
5.3.2.4 Produktives Tun 442
5.3.3 Kognition: Praktische Reflexion 443
5.3.3.1 Zusammenhang zwischen Denken und Handeln 443
5.3.3.2 Einfluss des Körpers auf reflexive Prozesse 445
5.3.3.3 Handlungsbegleitende Reflexion 445
5.3.4 Sprache: Symbolischer Ausdruck 447
5.3.4.1 Körper und Sprache 447
5.3.4.2 Handlung und Ausdruck 448
5.3.4.3 Entwicklung und Bedeutung der Symbolbildung 449
5.4 Rahmenbedingungen ästhetischer Erfahrung 450
5.4.1 Materielle Einflussfaktoren 450
5.4.1.1 Aufforderungscharakter von Materialien 450
5.4.1.2 Sichtbarkeit von Materialien 451
5.4.1.3 Handlungspotentiale von Materialien 452
5.4.1.4 Bekanntheit und Vertrautheit von Materialien 452
5.4.2 Soziale Einflussfaktoren 454
5.4.2.1 Soziales Umfeld 454
5.4.2.2 Sozial-emotionale Sicherheit 457
5.4.2.3 Anerkennung und Bewertung 460
5.4.2.4 Soziale Eingebundenheit 463
6 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick 467
6.1 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse und Ausblick 467
6.1.1 Theoretisches Fundament 467
6.1.2 Theoretische Modellierung 468
6.1.2.1 Strukturmodell ästhetischer Erfahrung 469
6.1.2.1.1 Innerpsychische Faktoren 470
6.1.2.1.2 Dispositionelle und soziale Faktoren 472
6.1.2.2 Prozessmodell ästhetischer Erfahrung 475
6.2 Forschungsbedarf 476
6.2.1 Strukturmerkmale ästhetischer Erfahrung 477
6.2.1.1 Innerpsychische Faktoren 477
6.2.1.2 Dispositionelle und soziale Faktoren 477
6.2.2 Prozessmerkmale ästhetischer Erfahrung 478
6.2.3 Forschungsmethodische Aspekte 478
6.3 Kunstpädagogische Konsequenzen 480
6.3.1 Innerpsychische Faktoren 480
6.3.2 Dispositionelle und soziale Faktoren 481
Abbildungsverzeichnis 483
Literaturverzeichnis 485
1.1 Forschungsinteresse 15
1.2 Theoretische Bezugspunkte 16
1.3 Struktur der Forschungsarbeit 17
2 Theoretische Situierung 21
2.1 Grundannahmen über ästhetische Erfahrung 21
2.1.1 Bedeutung ästhetischer Erfahrung für das Lebensalter der frühen Kindheit 22
2.1.2 Struktur von Erfahrungsprozessen 23
2.1.3 Ästhetischer Modus von Erfahrung 24
2.1.4 Kindliche und ästhetische Prozesse 26
2.1.5 Konsequenzen für die Forschungsarbeit 26
2.2 Modelle und Konzepte über die Struktur ästhetischer
Erfahrungsprozesse 27
2.2.1 Theorienmodelle aus Kunstpädagogik und Erziehungswissenschaft 27
2.2.1.1 Kunstpädagogik: Strukturmerkmale ästhetischer Erfahrungsprozesse
nach Georg Peez 28
2.2.1.2 Erziehungswissenschaft: Strukturmomente ästhetischer Erfahrung nach Ludwig Duncker 30
2.2.1.3 Synopse der Theoriemodelle aus Kunstpädagogik
und Erziehungswissenschaft 33
2.2.2 Theoriemodelle aus Philosophie, Psychologie und Soziologie 34
2.2.2.1 Philosophie: Thesen über die Struktur ästhetischer Erfahrung
nach Martin Seel 34
2.2.2.2 Psychologie: Kognitionspsychologisches Modell ästhetischer
Erfahrung nach Benno Belke und Helmut Leder 36
2.2.2.3 Soziologie: Struktureigenschaften ästhetischer Erfahrung
nach Ulrich Oevermann 39
2.2.2.4 Synopse der Theoriemodelle aus Philosophie,
Psychologie und Soziologie 41
2.2.3 Synthese der fünf Theoriemodelle 42
2.2.3.1 Theorieverständnisse von ästhetischer Erfahrung 42
2.2.3.1.1 Ästhetische Ausprägung von Erfahrung 43
2.2.3.1.2 Disposition des Subjekts 45
2.2.3.1.3 Entstehung ästhetischer Erfahrung 46
2.2.3.1.4 Ästhetische Erfahrung in Kunst und Alltag 48
2.2.3.2 Strukturbestimmungen von ästhetischer Erfahrung 49
2.2.3.2.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Theoriemodelle 49
2.2.3.2.2 Struktur- und Prozessmodell 50
2.2.3.2.3 Strukturmerkmale 51
2.3 Ästhetische Erfahrung in der frühen Kindheit 55
2.3.1 Theoretische Grundannahmen über ästhetische Erfahrung im Kindesalter 55
2.3.2 Wahrnehmung 59
2.3.2.1 Entwicklungspsychologie 59
2.3.2.2 Kunstpädagogik 62
2.3.3 Emotion 64
2.3.3.1 Entwicklungspsychologie 64
2.3.3.2 Kunstpädagogik 66
2.3.4 Kognition 68
2.3.4.1 Entwicklungspsychologie 69
2.3.4.2 Kunstpädagogik 75
2.3.5 Exploration und Spiel 81
2.3.5.1 Entwicklungspsychologie 82
Exploration 83
Spiel 85
2.3.5.2 Kunstpädagogik 87
Experimentieren 88
Spielen 89
2.4 Relevanz der theoretischen Grundlagen
für die empirische Untersuchung 92
3 Grundlagen der empirischen Untersuchung 95
3.1 Forschungsstand 95
3.2 Methodologische Grundsatzüberlegungen der Forschungsarbeit 99
3.2.1 Qualitative Kindheitsforschung 99
3.2.2 Gegenstandsangemessenheit der verwendeten Forschungsmethoden 102
3.2.2.1 Handlungsbeobachtung 102
3.2.2.1.1 Teilnehmende Beobachtung 103
3.2.2.1.2 Videografie 106
3.2.2.1.3 Kombination von Teilnehmender Beobachtung und Videografie 111
3.2.2.2 Interview 112
3.2.2.2.1 Qualitative Interviews mit Kindern 112
3.2.2.2.2 Kind-angemessene Interviewformen 115
3.2.2.3 Phänomenologische Analyse 118
3.2.3 Anlage der empirischen Untersuchung 120
3.2.4 Setting 126
3.2.5 Fallauswahl 131
4 Einzelfallanalysen 133
4.1 Fallbeispiel 1: Salome 133
4.1.1 Rekonstruktion des Handlungsprozesses von Salome 133
4.1.1.1 BE 1: Die graphischen Äußerungen des Kindes 135
4.1.1.1.1 Exploratives Verhalten 135
4.1.1.1.2 Spuren hinterlassen mit dem eigenen Körper 139
4.1.1.1.3 Handlungsmotive des Spurenerzeugens 142
4.1.1.1.4 Graphische Äußerungen zwischen Zeichnen und Malen 145
4.1.1.2 BE 2: Arbeiten mit dem Material Flüssigklebstoff 148
4.1.1.2.1 Materialumgang 148
4.1.1.2.2 Exploratives Handeln mit einem ungewöhnlichen Zeichenmaterial 151
4.1.1.2.3 „Das Gleiche immer anders“ –
Vertiefung durch Wiederholung und Modifikation 153
4.1.1.3 BE 3: Papier-Rollen 156
4.1.1.3.1 Erschaffung eines Kreises mittels Zeichenhilfe 156
4.1.1.3.2 Die selbst hergestellte Papierrolle 159
4.1.1.3.3 „Der Kreis schließt sich“ –
Gemeinsamkeit der Handlungsphasen mit Papierrollen 164
4.1.1.4 BE 4: Wechsel als ein dem bildnerischen Prozess innewohnendes Element 165
4.1.1.4.1 Körper und Bewegung 165
4.1.1.4.2 Bildnerische Grundsatzentscheidungen 169
4.1.1.4.3 Fließende und abrupte Übergänge 177
4.1.1.5 BE 5: Autonomiebestreben des Kindes 177
4.1.1.5.1 Autonomes Verhalten im bildnerischen Prozess 177
4.1.1.5.2 Grenzen des Autonomiebestrebens 181
4.1.1.6 BE 6: Bekanntes und Vertrautes 182
4.1.1.6.1 Die Bedeutung vertrauter Personen für den bildnerischen Prozess 182
4.1.1.6.2 Die Bedeutung bekannter Materialien für den bildnerischen Prozess 187
4.1.1.7 BE 7: Ordnung und Regeln 191
4.1.1.7.1 Materialnutzung 191
4.1.1.7.2 Reaktionen auf Handlungsaufforderungen 193
4.1.2 Rekonstruktion des Interviews mit Salome 197
4.1.2.1 BE 1: Klebstoffnutzung 198
4.1.2.1.1 Verwendungsformen des Materials Flüssigklebstoff 198
4.1.2.1.2 Klebstoff als Zeichenmaterial in Verbindung mit einer
Motivvorstellung 201
4.1.2.1.3 Auswirkung der Klebstoffnutzung auf den bildnerischen Prozess 202
4.1.2.2 BE 2: Das „Schneiden“ und das „Ausgeschnittene“ 203
4.1.2.2.1 Relevanz des Ausgeschnittenen 203
4.1.2.2.2 Eigene Interessen vertreten 205
4.1.2.2.3 Von der Ersatzhandlung zum Verfolgen eigener Interessen 207
4.1.2.2.4 Stellenwert des Aus-Schneidens 208
4.1.2.3 BE 3: „Kreis als Metapher“ – Bedeutung des Kreises und des Kreisens 209
4.1.2.3.1 Zwischen Prozesserleben und Zielausrichtung 209
4.1.2.3.2 „Kreisende Annäherungen“ – Versuche zur Erzeugung von Kreisen 210
4.1.2.3.3 Kreismotiv als zentrales Prinzip des Handlungsprozesses 214
4.1.2.4 BE 4: Prozesserleben 216
4.1.2.4.1 Ganzheitliches Erleben des Handlungsprozesses 216
4.1.2.4.2 Bewusste und unbewusste Handlungsentscheidungen 217
4.1.2.4.3 „Sich im Kreise drehen“ – Ineinandergreifen von Handlungen 218
4.1.2.5 BE 5: Der bildnerische Prozess als Problemlöseprozess 219
4.1.2.5.1 Herausforderungen 219
4.1.2.5.2 Scheitern und Erfolg 222
4.1.2.6 BE 6: Kognitive Durchdringung des Handlungsprozesses 226
4.1.2.6.1 Sprechen über den zurückliegenden Handlungsprozess 227
4.1.2.6.2 Antizipation bildnerischer Vorhaben 229
4.2 Fallbeispiel 2: Ben 232
4.2.1 Rekonstruktion des Handlungsprozesses von Ben 232
4.2.1.1 BE 1: Das Objekt „Holzkästchen“ und damit
verbundene Handlungsformen 234
4.2.1.1.1 Äußere Merkmale und Funktion des Objekts 234
4.2.1.1.2 Interesse am Objekt 236
4.2.1.1.3 Verschiedene Tätigkeiten mit dem Objekt 237
4.2.1.2 BE 2: Handlungen mit dem Material Flüssigklebstoff 239
4.2.1.2.1 Materialhandlungen in Zusammenhang mit dem Objekt
„Holzkästchen“ 239
4.2.1.2.2 Materialexploration 243
4.2.1.2.3 Erkenntnis: Materialeigenschaft Viskosität 245
4.2.1.2.4 Vergleich der Handlungen mit dem Material Flüssigklebstoff 246
4.2.1.2.5 Sinnliches Erleben des Materials 247
4.2.1.3 BE 3: Herstellung von „weißem Kleber“ 249
4.2.1.3.1 Von der Exploration zur Produktion 249
4.2.1.3.2 Bedeutung von Prozess und Produkt 250
4.2.1.3.3 Autonomie und Anerkennung 253
4.2.1.4 BE 4: Gleichförmigkeit des Handlungsprozesses 254
4.2.1.4.1 Konstanz der verwendeten Materialien 254
4.2.1.4.2 Gleichförmigkeit der Handlungen 256
4.2.1.5 BE 5: Ruhe und Ausgeglichenheit des Kindes 259
4.2.1.5.1 Beobachten und Handeln 259
4.2.1.5.2 Strategien der Weiterführung von Handlungen 262
4.2.1.5.3 Reaktionen auf Störungen 264
4.2.1.5.4 Kontakt zum Gegenstand 266
4.2.1.6 BE 6: Vorbilder suchen und Vorbild sein 268
4.2.1.6.1 Soziale Rahmung der Handlungssituation 268
4.2.1.6.2 Bildnerische Orientierungspunkte im Handlungsprozess 271
4.2.1.6.3 Körper und Handlung 273
4.2.1.7 BE 7: Regeln und Umgangsformen 274
4.2.1.7.1 Regelkonformes Verhalten 274
4.2.1.7.2 Regelbrüche 276
4.2.2 Rekonstruktion des Interviews mit Ben 279
4.2.2.1 BE 1: „Weißer Kleber“ 281
4.2.2.1.1 Wichtigkeit des aus dem Handlungsprozess hervorgegangenen
Erzeugnisses 281
4.2.2.1.2 Ein „Klebdings“ basteln 283
4.2.2.1.3 Ausschließlichkeit in Bezug auf die inhaltliche Schwerpunktsetzung 284
4.2.2.1.4 Klebstoffherstellung 286
4.2.2.2 BE 2: Handlungen mit dem Material Flüssigklebstoff 287
4.2.2.2.1 Klebstoffexploration 287
4.2.2.2.2 „Malen“ mit Flüssigklebstoff 289
4.2.2.3 BE 3: Offenheit für Materialien und Tätigkeiten 291
4.2.2.3.1 Prinzipielle Austauschbarkeit von Materialien und Verfahren 291
4.2.2.3.2 Relevanz von Zufällen im bildnerischen Prozess 292
4.2.2.4 BE 4: Ästhetische Werturteile 295
4.2.2.4.1 Objekte bewerten 296
4.2.2.4.2 Prozesse bewerten 298
4.2.2.5 BE 5: Der Handlungsprozess im Kontext des Sozialgefüges 299
4.2.2.5.1 Bildnerische Orientierung an anderen 299
4.2.2.5.2 Von der übernommenen Tätigkeit zur eigenständigen Idee 301
4.2.2.5.3 Vorbilder haben und Vorbild sein 303
4.2.2.5.4 Von der Einzel- zur Teamarbeit 305
4.2.2.5.5 Soziale Beziehung 307
4.2.2.6 BE 6: Körper und Sprache 309
4.2.2.6.1 Redebeteiligung am Interview 309
4.2.2.6.2 Sprachliche Gestaltungsmittel und körpersprachliche
Ausdrucksformen 311
4.2.2.6.3 Gefühlsäußerungen 313
4.2.2.6.4 Atmung 315
4.3 Zusammenfassungen der Einzelfälle 316
4.3.1 Der Einzelfall Salome 316
4.3.2 Der Einzelfall Ben 318
4.3.3 Synopse der beiden Einzelfälle 319
4.4 Reflexion der Forscherrolle 321
4.4.1 Auswirkung der forschungsmethodischen Entscheidungen
und Vorgehensweisen bei der Datenerhebung der Handlungssituationen 322
4.4.1.1 Verhalten im Feld 322
4.4.1.2 Einfluss des theoretischen Vorverständnisses auf die Datenerhebung 323
4.4.2 Auswirkung der forschungsmethodischen Entscheidungen und
des forschungsmethodischen Vorgehens bei der Datenerhebung der Interviews 325
4.4.2.1 Qualitatives Interview 325
4.4.2.2 Alter der Probanden 327
4.4.2.3 Sozialform 328
4.4.2.4 Fotografien als Erzählstimulus 330
4.4.3 Konsequenzen für die Datenauswertung 333
5. Synthetische Interpretation der Einzelfallanalysen 337
5.1 Strukturmerkmale ästhetischer Erfahrung 338
5.1.1 Einstellung 338
5.1.1.1 Offenheit 338
5.1.1.2 Flexibilität 341
5.1.1.3 Interesse 343
5.1.2 Wahrnehmung 344
5.1.2.1 Intermodale Wahrnehmung 345
5.1.2.2 Aufmerksamkeit 346
5.1.2.3 Konzentration 348
5.1.3 Handlung 349
5.1.3.1 Körperliche Aktivität 350
5.1.3.2 Aktivitäten der Welterschließung 353
5.1.3.2.1 Exploratives Handeln 353
5.1.3.2.2 Spielerisches Handeln 355
5.1.4 Emotion 360
5.1.4.1 Selbstgenügsamkeit und Funktionslust 360
5.1.4.2 Positiv-emotionales Erleben 362
5.1.4.3 Sinnlich-emotionales Erleben 364
5.1.4.4 Ambivalente Gefühle 366
5.1.5 Motivation 367
5.1.5.1 Selbstwirksamkeit und Autonomie 368
5.1.5.2 Prozesse des Lernens 371
5.1.5.3 Entwicklungsstreben 375
5.1.6 Kognition 381
5.1.6.1 Denken und Erkenntnis 381
5.1.6.1.1 Handlungsbezogene Kognitionen 382
5.1.6.1.2 Handlungsabsicht 384
5.1.6.1.3 Staunen und Irritation 388
5.1.6.1.4 Wissen 389
5.1.6.2 Imagination 391
5.1.6.2.1 Vorstellung und Anschaulichkeit 392
5.1.6.2.2 Realität und Phantasie 392
5.1.6.2.3 Interdependenz von Bildvorstellung und bildnerischer Tätigkeit 393
5.1.6.2.4 Auswirkung von Kenntnissen auf die Entstehung von
Bildvorstellungen 394
5.1.6.2.5 Einfluss kontextueller Vorgaben auf die Realisation von
Bildvorstellungen 395
5.1.6.3 Reflexion 396
5.1.7 Ausdruck 400
5.1.7.1 Sprache 400
5.1.7.2 Objektivation 405
5.2 Prozessmerkmale ästhetischer Erfahrung 408
5.2.1 Rhythmus 409
5.2.1.1 Gleichförmigkeit und Wechsel 409
5.2.1.2 Körpererleben 412
5.2.1.3 Wechsel der Spannungszustände 413
5.2.2 Prozessentwicklung 414
5.2.2.1 Aktivitätszustand 414
5.2.2.2 Kontinuität und Brüche 415
5.2.2.3 Prozesshafte Entwicklung der Handlung 416
5.2.2.4 Aufrechterhaltung des Prozesses 418
5.2.2.5 Zusammenhänge zwischen Handlungsphasen 421
5.2.2.6 Prozessformen 424
5.2.2.7 Entwicklung von Bildvorstellungen 425
5.2.3 Intensität 426
5.2.3.2 Momentaneität und Simultaneität 427
5.2.3.3 Konzentration und Ausdauer 428
5.2.3.4 Prozess und Produkt 429
5.2.3.5 Monotonie und Abwechslung 430
5.3 Kindspezifische Merkmale ästhetischer Erfahrung 433
5.3.1 Motorik: Körperwahrnehmung und Körperbewegung 434
5.3.1.1 Zusammenwirken von Wahrnehmung und Motorik 434
5.3.1.2 Auswirkung der Motorik auf ästhetische Erfahrungsprozesse 435
5.3.1.3 Relevanz der Körperwahrnehmung für ästhetische Erfahrungsprozesse 436
5.3.2 Motivation: Personale und soziale Bezogenheit 439
5.3.2.1 Handlungsmotiviertes Tun 439
5.3.2.2 Körperliches Tun 440
5.3.2.3 Selbstzweckhaftes Tun 441
5.3.2.4 Produktives Tun 442
5.3.3 Kognition: Praktische Reflexion 443
5.3.3.1 Zusammenhang zwischen Denken und Handeln 443
5.3.3.2 Einfluss des Körpers auf reflexive Prozesse 445
5.3.3.3 Handlungsbegleitende Reflexion 445
5.3.4 Sprache: Symbolischer Ausdruck 447
5.3.4.1 Körper und Sprache 447
5.3.4.2 Handlung und Ausdruck 448
5.3.4.3 Entwicklung und Bedeutung der Symbolbildung 449
5.4 Rahmenbedingungen ästhetischer Erfahrung 450
5.4.1 Materielle Einflussfaktoren 450
5.4.1.1 Aufforderungscharakter von Materialien 450
5.4.1.2 Sichtbarkeit von Materialien 451
5.4.1.3 Handlungspotentiale von Materialien 452
5.4.1.4 Bekanntheit und Vertrautheit von Materialien 452
5.4.2 Soziale Einflussfaktoren 454
5.4.2.1 Soziales Umfeld 454
5.4.2.2 Sozial-emotionale Sicherheit 457
5.4.2.3 Anerkennung und Bewertung 460
5.4.2.4 Soziale Eingebundenheit 463
6 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick 467
6.1 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse und Ausblick 467
6.1.1 Theoretisches Fundament 467
6.1.2 Theoretische Modellierung 468
6.1.2.1 Strukturmodell ästhetischer Erfahrung 469
6.1.2.1.1 Innerpsychische Faktoren 470
6.1.2.1.2 Dispositionelle und soziale Faktoren 472
6.1.2.2 Prozessmodell ästhetischer Erfahrung 475
6.2 Forschungsbedarf 476
6.2.1 Strukturmerkmale ästhetischer Erfahrung 477
6.2.1.1 Innerpsychische Faktoren 477
6.2.1.2 Dispositionelle und soziale Faktoren 477
6.2.2 Prozessmerkmale ästhetischer Erfahrung 478
6.2.3 Forschungsmethodische Aspekte 478
6.3 Kunstpädagogische Konsequenzen 480
6.3.1 Innerpsychische Faktoren 480
6.3.2 Dispositionelle und soziale Faktoren 481
Abbildungsverzeichnis 483
Literaturverzeichnis 485