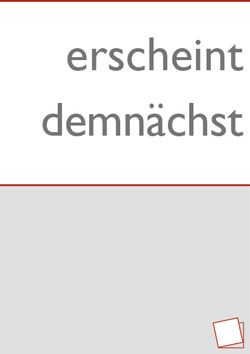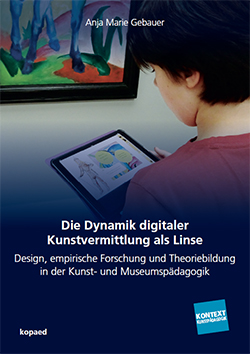Kontext Kunstpädagogik
Unsichtbare Kunst und ihre didaktischen Perspektiven
Schriftenreihe Kontext Kunstpädagogik
Band 31, München 2011, 300 Seiten
ISBN 978-3-86736-131-6
Produktbeschreibung
Es gibt künstlerische Ausdrucksformen, bei denen der Einstieg in eine Auseinandersetzung nicht über wahrnehmbare Materialien und Formeigenschaften funktioniert, weil die Werke nicht sichtbar sind und sich demzufolge einer sinnlich-visuellen Wahrnehmung entziehen. Gleichwohl bieten gerade sie die Möglichkeit, den Betrachter durch ihre Präsenz so nachhaltig zu irritieren, dass er im Prozess einer gesteigerten Konzentration zu gänzlich neuen Erkenntnissen gelangt, die einen überraschenden Bezug zu seiner Lebenswelt ermöglichen.
Im 20. Jahrhundert findet das Thema Eingang in die bildende Kunst und erlebt in den 1960er und 1970er Jahren seinen bisherigen Höhepunkt. Im Gegensatz zu anderen Tendenzen der Nachkriegskunst wurden solche unsichtbaren Werke trotz ihrer kunsthistorisch unumstrittenen Bedeutung von der Kunstdidaktik bislang nahezu vollständig ignoriert.
Das Erleben von Kunstwerken ist das zentrale Anliegendes Kunstunterrichts und basiert größtenteils auf optisch-visuell vermittelten Inhalten. Im Zentrum steht alles, was sich „primär visuell, über den Sehsinn vermittelt“. Darauf deuten auch einschlägige Formulierungen wie „Sehen Lernen“,„Gebrauch der Sinne“ oder „visuelle Kompetenz“.
Dabei gibt es genügend Gründe, die für eine Beschäftigung mit unsichtbaren Phänomenen sprechen: Unsichtbare Werke spiegeln vielfältige Phänomene unserer Lebenswirklichkeit – beispielsweise die nicht sichtbaren Wirkungen radioaktiver Strahlung –, werfen wichtige Fragen auf und ermöglichen eine Auseinandersetzung mit den Grenzen der visuellen Wahrnehmung.
Die traditionelle Auffassung, der Umgang mit Kunst im Unterricht müsse vornehmlich auf visuellen Wegen stattfinden und eine Verfeinerung der optischen Wahrnehmung zum Ziel haben, soll im Rahmen der Dissertation widerlegt werden, um eine weiterreichende Perspektive eines zeitgemäßen Verständnisses des Faches Kunst zu geben.
Im 20. Jahrhundert findet das Thema Eingang in die bildende Kunst und erlebt in den 1960er und 1970er Jahren seinen bisherigen Höhepunkt. Im Gegensatz zu anderen Tendenzen der Nachkriegskunst wurden solche unsichtbaren Werke trotz ihrer kunsthistorisch unumstrittenen Bedeutung von der Kunstdidaktik bislang nahezu vollständig ignoriert.
Das Erleben von Kunstwerken ist das zentrale Anliegendes Kunstunterrichts und basiert größtenteils auf optisch-visuell vermittelten Inhalten. Im Zentrum steht alles, was sich „primär visuell, über den Sehsinn vermittelt“. Darauf deuten auch einschlägige Formulierungen wie „Sehen Lernen“,„Gebrauch der Sinne“ oder „visuelle Kompetenz“.
Dabei gibt es genügend Gründe, die für eine Beschäftigung mit unsichtbaren Phänomenen sprechen: Unsichtbare Werke spiegeln vielfältige Phänomene unserer Lebenswirklichkeit – beispielsweise die nicht sichtbaren Wirkungen radioaktiver Strahlung –, werfen wichtige Fragen auf und ermöglichen eine Auseinandersetzung mit den Grenzen der visuellen Wahrnehmung.
Die traditionelle Auffassung, der Umgang mit Kunst im Unterricht müsse vornehmlich auf visuellen Wegen stattfinden und eine Verfeinerung der optischen Wahrnehmung zum Ziel haben, soll im Rahmen der Dissertation widerlegt werden, um eine weiterreichende Perspektive eines zeitgemäßen Verständnisses des Faches Kunst zu geben.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Unsichtbare Kunst?
TEIL 1: HISTORISCH-THEORETISCHE UNTERSUCHUNG
1. Unsichtbare Kunst und Kunstpädagogik
Unsichtbare Kunst: Aktuelles Phänomen und historische Erscheinung
Das Ignorieren unsichtbarer Kunst seitens der Didaktik
Die Rolle der unsichtbaren Kunst im Unterricht der 1960er und
1970er Jahre
Kunstpädagogen über Ausstellungen und Gegenwartskunst 1968–1972
Unsichtbare Kunst und Kunstpädagogik der 1960er und 1970er Jahre
Ansätze zur Vermittlung von Gegenwartskunst im Schulkontext
Gunter Ottos Einwand gegen »unsinnliche« Kunst
Resümee und Problemstellung
Kunstpädagogik und Gegenwartskunst der 1960er und 1970er Jahre
Gegenwartskunst und Kunstpädagogik seit den 1980er Jahren
Frage- und Problemstellung
2. »Dematerialisierung« der Kunst?
Kunstkritik in den USA: »Formal Criticism«
Visuelle Rezeption und imaginierender Betrachter
Öffnung des Kunstdiskurses zur Rezeptionsästhetik
Immaterialität des Konzepts und Unsichtbarkeit
Resümee
3. Begriffliche Eingrenzung unsichtbarer Kunst
Abwesenheit und Leere
Entleerte Bildflächen
Leere Räume
Anwesenheit und Vorhandensein
Werkmittel Luft
Robert Barrys unsichtbare Kunst
Ursächliche Unsichtbarkeit
Exkurs: Unsichtbarkeit in christlicher Bildkultur
Robert Barrys Inert Gas Series
Blüte und vorläufiges Abklingen unsichtbarer Kunst
Ausstellungspräsenz in den USA und Europa
Robert Barrys weitere Entwicklung und seine Abkehr von unsichtbarer Kunst
Resümee
4. Kategorien unsichtbarer Kunst
Kategorie I: Über Absenz vermittelte Unsichtbarkeit (Leere)
Sprachlich vermittelte Absenz
Entleerte Präsentation
Kategorie II: Über Präsenz vermittelte Unsichtbarkeit
Kategorie III: Indexalisch/ursächlich vermittelte Unsichtbarkeit
Resümee
5. Zur Rezeption unsichtbarer Kunst
Zeitgeschichtliche Annäherung
Unsicherheit in der Kunstkritik?
Bruch mit der Tradition?
Überforderung des Betrachters?
Philosophische Annäherung (Präsenz und Erscheinen unsichtbarer Kunst)
Präsenz von nicht sinnlich Wahrnehmbarem
Erscheinen von Unsichtbarem
Unsichtbares als Gegenstand ästhetischer Wahrnehmung
Wahrnehmung und Kontext
Bedeutung schaffen
Resümee
6. Zwischenbilanz
TEIL 2: EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
7. Methodologische Basis der empirischen Untersuchung
Grundlegendes
Die Vorgehensweise
Qualitative Empirie
Qualitative Inhaltsanalyse
Triangulation
Datenerhebungsmethoden
Leitfadeninterview
Episodisches Interview
Interviewtechnik: Qualitative Online-Befragung
Praktische Schülerarbeiten
Datenauswertungsmethoden
Kontrastierung von Einzelfallstudien
Chat-Analyse
Theoriegeleitete induktive Kategorienbildung
Werkanalyse
Resümee
8. Setting und Ablauf der Untersuchung
Fragestellung im Unterrichtskontext
Kontextfaktoren der unterrichtlichen Situation
Rahmenbedingungen
Die Orte der Untersuchung
Ablauf der Untersuchung und zeitlicher Rahmen
Beschreibung der Initialphase (Interview)
Beschreibung der Prozessphase Teil 1 (Carrier Wave Piece)
Beschreibung der Prozessphase Teil 2: Entwicklung der Arbeiten
Beschreibung der Präsentationsphase (Ausstellungsaufbau)
Beschreibung der Reflexionsphase
Resümee und Festlegung des Materials
9. Bildung von Kategorien und Auswahl der Fallbeispiele
Die Kategorien der Inhaltsanalyse
Kontextbezogene Verhaltensdisposition
Konstellation Werkbegriff
Prävalente Künstlerrolle
Modifikation der Wahrnehmung
Rezeptionsprozess
Auswahl der Fallbeispiele Carlotta, Jana und Furkan
Kontextbezogene Verhaltensdisposition
Konstellation Werkbegriff
Prävalente Künstlerrolle
Modifikation der Wahrnehmung
Rezeptionsprozess
Resümee
10. Beschreibung der Fallbeispiele
Beschreibung des Falls Jana
Initialphase
Produktionsphase
Bildnerische Werke
Reflexionsphase
Beschreibung des Falls Carlotta
Initialphase
Produktionsphase
Bildnerische Arbeiten
Reflexionsphase
Beschreibung des Falls Furkan
Initialphase
Produktionsphase
Bildnerische Arbeiten
Reflexionsphase
11. Einschätzung der Fallbeispiele
Einschätzung des Fallbeispiels Jana
Initialphase
Produktionsphase und bildnerische Arbeiten
Reflexionsphase
Zusammenfassung
Einschätzung des Fallbeispiels Carlotta
Initialphase
Produktionsphase und bildnerische Arbeiten
Reflexionsphase: Modifizierte Wahrnehmungshaltung
Zusammenfassung
Einschätzung des Fallbeispiels Furkan
Initialphase
Produktionsphase und bildnerische Arbeiten
Reflexionsphase
Zusammenfassung
Resümee
12. Die Leistung unsichtbarer Kunst im Unterricht
Modifikation der Verhaltensdisposition
Konstellation Werkbegriff
Vom geschlossenen zum offenen Werk
Die sichtbare Form
Prävalente Künstlerrolle
Modifikation der Wahrnehmung: »Wahrnehmen« statt »sehen«
Rezeptionsprozess
Resümee
13. Ausblick mit Lücken
Literatur
Abbildungen
TEIL 1: HISTORISCH-THEORETISCHE UNTERSUCHUNG
1. Unsichtbare Kunst und Kunstpädagogik
Unsichtbare Kunst: Aktuelles Phänomen und historische Erscheinung
Das Ignorieren unsichtbarer Kunst seitens der Didaktik
Die Rolle der unsichtbaren Kunst im Unterricht der 1960er und
1970er Jahre
Kunstpädagogen über Ausstellungen und Gegenwartskunst 1968–1972
Unsichtbare Kunst und Kunstpädagogik der 1960er und 1970er Jahre
Ansätze zur Vermittlung von Gegenwartskunst im Schulkontext
Gunter Ottos Einwand gegen »unsinnliche« Kunst
Resümee und Problemstellung
Kunstpädagogik und Gegenwartskunst der 1960er und 1970er Jahre
Gegenwartskunst und Kunstpädagogik seit den 1980er Jahren
Frage- und Problemstellung
2. »Dematerialisierung« der Kunst?
Kunstkritik in den USA: »Formal Criticism«
Visuelle Rezeption und imaginierender Betrachter
Öffnung des Kunstdiskurses zur Rezeptionsästhetik
Immaterialität des Konzepts und Unsichtbarkeit
Resümee
3. Begriffliche Eingrenzung unsichtbarer Kunst
Abwesenheit und Leere
Entleerte Bildflächen
Leere Räume
Anwesenheit und Vorhandensein
Werkmittel Luft
Robert Barrys unsichtbare Kunst
Ursächliche Unsichtbarkeit
Exkurs: Unsichtbarkeit in christlicher Bildkultur
Robert Barrys Inert Gas Series
Blüte und vorläufiges Abklingen unsichtbarer Kunst
Ausstellungspräsenz in den USA und Europa
Robert Barrys weitere Entwicklung und seine Abkehr von unsichtbarer Kunst
Resümee
4. Kategorien unsichtbarer Kunst
Kategorie I: Über Absenz vermittelte Unsichtbarkeit (Leere)
Sprachlich vermittelte Absenz
Entleerte Präsentation
Kategorie II: Über Präsenz vermittelte Unsichtbarkeit
Kategorie III: Indexalisch/ursächlich vermittelte Unsichtbarkeit
Resümee
5. Zur Rezeption unsichtbarer Kunst
Zeitgeschichtliche Annäherung
Unsicherheit in der Kunstkritik?
Bruch mit der Tradition?
Überforderung des Betrachters?
Philosophische Annäherung (Präsenz und Erscheinen unsichtbarer Kunst)
Präsenz von nicht sinnlich Wahrnehmbarem
Erscheinen von Unsichtbarem
Unsichtbares als Gegenstand ästhetischer Wahrnehmung
Wahrnehmung und Kontext
Bedeutung schaffen
Resümee
6. Zwischenbilanz
TEIL 2: EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
7. Methodologische Basis der empirischen Untersuchung
Grundlegendes
Die Vorgehensweise
Qualitative Empirie
Qualitative Inhaltsanalyse
Triangulation
Datenerhebungsmethoden
Leitfadeninterview
Episodisches Interview
Interviewtechnik: Qualitative Online-Befragung
Praktische Schülerarbeiten
Datenauswertungsmethoden
Kontrastierung von Einzelfallstudien
Chat-Analyse
Theoriegeleitete induktive Kategorienbildung
Werkanalyse
Resümee
8. Setting und Ablauf der Untersuchung
Fragestellung im Unterrichtskontext
Kontextfaktoren der unterrichtlichen Situation
Rahmenbedingungen
Die Orte der Untersuchung
Ablauf der Untersuchung und zeitlicher Rahmen
Beschreibung der Initialphase (Interview)
Beschreibung der Prozessphase Teil 1 (Carrier Wave Piece)
Beschreibung der Prozessphase Teil 2: Entwicklung der Arbeiten
Beschreibung der Präsentationsphase (Ausstellungsaufbau)
Beschreibung der Reflexionsphase
Resümee und Festlegung des Materials
9. Bildung von Kategorien und Auswahl der Fallbeispiele
Die Kategorien der Inhaltsanalyse
Kontextbezogene Verhaltensdisposition
Konstellation Werkbegriff
Prävalente Künstlerrolle
Modifikation der Wahrnehmung
Rezeptionsprozess
Auswahl der Fallbeispiele Carlotta, Jana und Furkan
Kontextbezogene Verhaltensdisposition
Konstellation Werkbegriff
Prävalente Künstlerrolle
Modifikation der Wahrnehmung
Rezeptionsprozess
Resümee
10. Beschreibung der Fallbeispiele
Beschreibung des Falls Jana
Initialphase
Produktionsphase
Bildnerische Werke
Reflexionsphase
Beschreibung des Falls Carlotta
Initialphase
Produktionsphase
Bildnerische Arbeiten
Reflexionsphase
Beschreibung des Falls Furkan
Initialphase
Produktionsphase
Bildnerische Arbeiten
Reflexionsphase
11. Einschätzung der Fallbeispiele
Einschätzung des Fallbeispiels Jana
Initialphase
Produktionsphase und bildnerische Arbeiten
Reflexionsphase
Zusammenfassung
Einschätzung des Fallbeispiels Carlotta
Initialphase
Produktionsphase und bildnerische Arbeiten
Reflexionsphase: Modifizierte Wahrnehmungshaltung
Zusammenfassung
Einschätzung des Fallbeispiels Furkan
Initialphase
Produktionsphase und bildnerische Arbeiten
Reflexionsphase
Zusammenfassung
Resümee
12. Die Leistung unsichtbarer Kunst im Unterricht
Modifikation der Verhaltensdisposition
Konstellation Werkbegriff
Vom geschlossenen zum offenen Werk
Die sichtbare Form
Prävalente Künstlerrolle
Modifikation der Wahrnehmung: »Wahrnehmen« statt »sehen«
Rezeptionsprozess
Resümee
13. Ausblick mit Lücken
Literatur
Abbildungen